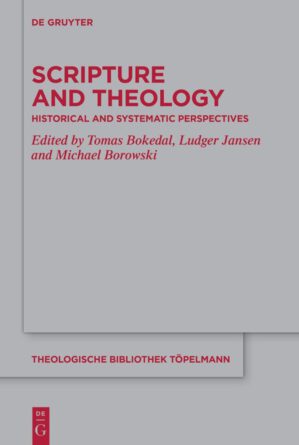Tomas Bokedal / Ludger Jansen / Michael Borowski (Hg.): Scripture and Theology
Tomas Bokedal / Ludger Jansen / Michael Borowski (Hg.): Scripture and Theology. Historical and Systematic Perspectives, Theologische Bibliothek Töpelmann 201, Berlin: De Gruyter, 2023, geb., VIII+489 S., € 114,95, ISBN 978-3-11-076826-8
Diese Anthologie bietet 19 englischsprachige Beiträge von Verfassern unterschiedlicher nationaler und konfessioneller Herkunft, die auf zwei Jahreskonferenzen der „European Academy of Religion“ (Bologna) dargeboten wurden. Als Einleitung (1–31) schicken die Herausgeber eine Kontextualisierung der alle Beiträge miteinander verbindenden Frage nach der Relation von Schrift und Theologie in theologiegeschichtlicher Perspektive voraus und stellen die Beiträge vor. Letztere sind plausibel eingeteilt in drei Hauptkapitel. Auf fünf exegetische Tiefenbohrungen unter der Kapitelüberschrift „Scripture and the Web of Meanings“ folgen in Kapitel II sieben wirkungsgeschichtlich orientierte „Historical Case Studies“. Sieben systematisch-theologische Perspektiven wurden schließlich unter dem Titel „Informing Theological Discourse“ gebündelt. Allen Beiträgen vorangestellt ist ebenfalls jeweils in englischer Sprache ein „Abstract“ sowie eine Aufzählung von „Keywords“. Jeder Autor bietet am Ende seines eigenen Textes eine Literaturliste dar („References“). Der Anhang besteht lediglich aus einer Auflistung der Autoren.
Der Reigen wird eröffnet durch eine sachkritische anthropologische Analyse von Ez 13,17–21, in der Jeanine Mukaminega (Brüssel) gegen die Intention des prophetischen Buches und unter Bezugnahme auf altorientalische Texte zur Prophetinnenthematik eine Exegese fordert, die herausarbeitet, was im biblischen Text an Diversität zum Schweigen gebracht wird. Torleif Elgvin (Oslo) widmet sich der komplexen Vielfalt von Messias- und Erlöser-Figuren in biblischen und außerbiblischen nachexilischen Texten. Wie die Verzahnung von Schrift, Narrativität und Bekenntnis im lukanischen Doppelwerk genutzt wird, um eine frühe Form „hoher“ Christologie zu entwerfen, ist Gegenstand der Untersuchung von Luuk van de Weghe (Aberdeen). In Auseinandersetzung mit Zahn, van Unnik, von Campenhausen und Kinzig sowie unter breiter Aufnahme patristischer und exegetischer Beobachtungen an Bibeltexten zum Begriff διαθήκη geht Tomas Bokedal (Aberdeen/Bergen) der Frage nach der Begründung der kanonstheoretischen Rede von einem „Neuen Testament“ nach. Komparatistisch orientiert ist die Betrachtung von fiktiven „Entdeckungsgeschichten“ in den Prologen des Sirachbuches, des apokryphen Nikodemusevangeliums sowie der sibyllinischen Orakel durch Francis Borchardt (Bergen).
Im kirchengeschichtlichen Teil untersucht die philippinische Gelehrte Beatrice Ang die Dynamik des gepredigten Wortes anhand von zwei Chrysostomospredigten. Willibald Sandler (Innsbruck) bietet eine Betrachtung zu Augustins Erbsündenlehre im Horizont seines Verständnisses von Röm 9–11 und Röm 5,12 im kritischen Gespräch mit Thomas Pröpper, Kurt Flasch und Karl Rahner. Wie aristotelische Psychologie und Metaphysik in der Auslegung des Aquinaten von Joh 1,14a wirksam wird, bedenkt Ludgar Jansen (Rostock). Knut Alfsvåg (Stavanger) widmet sich der Relation von biblischer Exegese und Theologie im Denken von Johann Georg Hamann und verortet diesen „between Luther and Hume“. Hier schlägt das Herz des Lesers höher, wenn er als Fazit liest: „Biblical interpretation is therefore in Hamann’s view the key to any kind of understanding of the world that has the aspiration of evolving beyond the mere registration of facts without dissolving into incoherence“ (279). Alison Milbank (Nottingham) entdeckt in der die Psalmensprache aufnehmenden Poesie der frühneuzeitlichen Dichter Henry Vaughan (1621–1695) und Christopher Smart (1722–1771) Vorläufer einer „Ökotheologie“, aber auch schon der Romantik. Zuletzt kommen auch Karl Barth (Brandon K. Watson, Münster: „The Divine Forwards: Karl Barth’s Early Exegesis of the Pauline Epistles“) und Karl Rahner (Georg Fischer, Innsbruck: „Karl Rahner’s Use of the Bible“) als Schriftausleger in den Blick.
Der systematisch-theologische Teil wird eröffnet durch einen adventistischen Beitrag von Boubakar Sanou und John C. Peckham (jeweils Berrien Springs, USA). Diese plädieren für einen dezidiert schriftkanonischen Theologieansatz in dialogisch-globaler Perspektive, durch den allein sowohl dogmatischer Objektivismus als auch subjektivistische Willkür zu vermeiden seien. Allerdings macht der Beitrag insofern ratlos, als man primär den Eindruck hat, hier sollen möglichst viele Kontexte miteinander ins Gespräch kommen. Dass die Schrift nicht um ihrer selbst willen, sondern um Christi willen und um des durch ihn vollbrachten und zu predigenden Heils willen die Theologie – in allen vorstellbaren Weltkontexten – bestimmen sollte, bleibt hierbei völlig unterbelichtet. Diese Christuszentriertheit der Schrift kommt durchaus sachgerechter in gleich zwei Beiträgen zur Geltung, die sich als reflektierte Plädoyers für eine vorsichtige Wiedergewinnung des Konzepts des vierfachen Schriftsinns lesen lassen (Hans Burger, Utrecht: Quadriga without Platonism. In Search for the Usefulness of the Fourfold Sense of Scripture in Dialogue with Hans Boersma; Arnold Huijgen, Amsterdam: Connecting Biblical Exegesis and Systematic Theology through the Anagogical-Eschatological Sense of Scripture). Hier lassen sich – ohne Aufgabe zentraler reformatorischer Einsichten zur Einfachheit des christologischen Schriftsinnes – Anknüpfungspunkte zur reflektierten und nach wie vor wegweisenden frühneuzeitlichen Bibelhermeneutik ausmachen, wenn Burger etwa von einer sakramentalen Präsenz Christi in der Schrift redet (394) oder wenn Huijgen für eine trinitarische Auslegung auch des Alten Testaments plädiert (410). Tatsächlich führt dies jeweils zu einer dezidiert soteriologisch-eschatologischen Perspektive, in der das Proprium der Schrift als Christuszeugnis nicht ausgeblendet wird. Mark W. Elliot (Toronto) lernt bei Hans Urs von Balthasar, dass eine betont theologische Kunst der Schriftauslegung notwendigerweise auf kirchliche Lehre (Dogmatik) drängt. Auch hier spielt – wesentlich durch das Johannesevangelium inspiriert – die trinitarische Perspektive eine Schlüsselrolle. Ida Heikkilä (Helsinki) und Elisabeth Maikranz (Heidelberg) behandeln in ihren Beiträgen das kontroverstheologisch wichtige Verhältnis von Schrift und Tradition. Maikranz knüpft dabei an Wolfhart Pannenbergs Ansatz an. Heikkilä wiederum würdigt das ökumenische Dialogdokument „Communio Sanctorum“ und bekräftigt in nachvollziehbarer Weise Grundzüge der durch die Tübinger evangelisch-theologische Fakultät formulierten Kritik an diesem Dokument. Michael Borowski (Amsterdam) fragt im Anschluss an die Theologie Vanhoozers nach einer sachgerechten theologischen Lehrentfaltung auf Basis der Heiligen Schrift.
Der Leser begegnet in diesem Band einem bunten Strauß von doch sehr heterogenen Beiträgen. Das reicht von solchen Beiträgen, die tatsächlich, um mit Jörg Baur zu sprechen, „im Gewande der wissenschaftlichen These […] eine religiöse Confessio gegen die Texte“ (Luther und seine klassischen Erben. Theologische Aufsätze und Forschungen, Tübingen: Mohr, 1993, 106) der Schrift aussprechen, bis hin zu solchen Beiträgen, mit denen man gerne in weiterführende Gespräche eintritt. Inwieweit die Autoren bei den eingangs erwähnten Konferenzen tatsächlich auch einen Dialog miteinander geführt haben, erfährt der Leser nicht. Wohl aber kündigen die Herausgeber in ihrem Vorwort die Fortsetzung des mit diesem Band und den darin dokumentierten Tagungen eröffneten Diskurses im Rahmen der „European Academy of Religion“ an, auf die man nun gespannt sein darf.
Prof. Dr. Armin Wenz, Lutherische Theologische Hochschule Oberursel