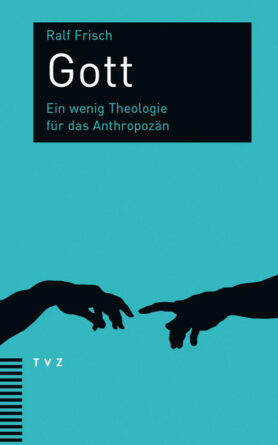Ralf Frisch: Gott
Ralf Frisch: Gott. Ein wenig Theologie für das Anthropozän, Zürich: TVZ, 2024, kt., 215 S., € 25,–, ISBN: 978-3-290-18662-3
Der Philosoph Wolfgang Welsch klagte vor einigen Jahren in Mensch und Welt (München: C. H. Beck, 2012, 23) darüber, dass das philosophische Denken durch eine anthropozentrische Denkform gelähmt sei. Man wisse immer schon die Antwort auf alle Fragen. „Sie lautet: ‚Es ist der Mensch.‘ Diese Trivialität aber erstickt unser Denken, statt ihm Atem zu verleihen.“ Ralf Frisch stimmt in seinem neuen Buch Gott dieser Bestandsaufnahme zu. Die Narrative des Anthropozäns seien metaphysisch hoffnungslos und überfordernd. (Das Anthropozän, von griechisch ἄνθρωπος „Mensch“ und καινός „neu“, ist ein inoffizieller Begriff für ein neues Erdzeitalter, das vor allem vom Menschen geprägt ist. Es beschreibt den Zeitraum, in dem menschliche Aktivitäten das Erdsystem und das Selbstverständnis in erheblichem Maße beeinflussen und verändern, insbesondere seit Beginn der industriellen Revolution.) Alles drehe sich um den Menschen. Er sei das Problem und die Lösung, der Schuldige und der Richter (vgl. 13). Es sei tragisch, dass sich die christliche Theologie diese anthropozentrische Denkweise angeeignet habe. Heute gebe es eine Theologie, die stolz darauf sei, ohne Gott auszukommen. Der Tod Gottes sei von vielen für theologisch unhintergehbar und normativ erklärt worden (vgl. 25). „Interessanterweise besteht zwischen der Theologie, der Philosophie und der Kosmologie unserer Zeit“, so Frisch, „kein nennenswerter weltanschaulicher Unterschied. Alle gehen sie davon aus, dass der Mensch in der Ungeheuerlichkeit des Alls auf sich selbst gestellt ist“ (29). Diese „aufgeklärte“ Theologie im Anthropozän sei suizidal. Sie ähnelt laut Frisch, „einem Menschen, der mit einem Strick um den Hals auf einem Stuhl steht und diesen Stuhl unter seinen Füssen wegzustossen sucht. Den Strick hat er sich selbst umgelegt. Die Unentrinnbarkeit und Alternativlosigkeit der Immanenz ist dieser Strick“ (50).
Die Theologie sei nur zu retten, wenn sie wieder den Mut fasse, von Gott zu reden. Denn: Die „Gottesfrage ist die eigentliche Frage unserer Zeit. Sie ist die Frage, an der sich die Zukunft der Theologie und die Zukunft der evangelischen Kirche entscheiden wird“ (53). „Dass Bäckereien eine Zukunft haben könnten, die beschliessen, Hungrigen fortan Steine statt Brot zu verkaufen, weil die Hungrigen diese Steine für Brot halten, ist undenkbar. Und genauso undenkbar ist es – hoffentlich –, dass die Kirche als Kirche überleben könnte, ohne etwas mit Gott zu tun haben zu wollen“ (135).
Aber wer ist dieser Gott, von dem die Kirche zu reden hat? Frisch verteidigt das „Deus semper maior“. Gott ist immer größer, als Menschen glauben und denken. Er übersteigt alle menschlichen Versuche, ihn mit der Vernunft zu fassen (vgl. 62). „Der Mensch ist Mensch. Und Gott ist Gott. […] Gott kann nicht das Wesen sein, dem die Welt überlegen sein könnte. Sonst wäre er nicht Gott“ (63). Doch auch wenn sich Gott den positiven Definitionen entziehe, könne ausgeführt werden, was Gott nicht ist. Gott sei kein vergöttlichter Mensch und keine Chiffre für humanitäre Solidarität (vgl. 64f). Gott könne laut Frisch auch keine unpersönliche Macht, sondern müsse ein personales Wesen sein. Denn ein „Gott, der keine Person ist, verdient den Namen Gott nicht. Ein Gott, der nur irgendwie da wäre, aber nicht wissen und fühlen würde, wie es ist, ‚da‘ zu sein, wäre kein Gott“ (71).
Es ärgert Frisch, dass die akademische Theologie verlernt hat, über Gott zu staunen. Sie duldet nicht, dass Gott die menschlichen Rationalisierungen aufbricht und „in den intellektuell, psychisch und moralisch abgeriegelten Raum der Welt eindringt“ (85). „Dass Gott in irgendeiner Weise zu fürchten und ihm nicht mit Hochmut, sondern mit Demut zu begegnen sein könnte, ist eine Vorstellung, die von der humanistischen Theologie unserer Gegenwart nahezu rückstandslos entsorgt wird“ (93). „Eine erschreckend weltfremde Identifizierung von Gott und Natur und von Gottvertrauen und Naturvertrauen im Namen einer naturverklärenden Schöpfungsspiritualität inklusive der theologisch im Blick auf den HERRN längst verabschiedeten Demuts- und Ehrfurchtrhetorik greift immer unverhohlener und immer unwidersprochener um sich“ (98). „Von Gottesfurcht und Gottesschrecken, die in der Bibel mit jeder Epiphanie einhergehen, ist vielleicht tatsächlich nur noch die Angst der aufgeklärten Christinnen und Christen übriggeblieben, Gott zum Thema zu machen“ (85f). Unter Berufung auf Rudolf Otto und Ludwig Wittgenstein plädiert Frisch dafür, das Unaussprechliche dadurch zu ehren, dass man anbetend schweigt (vgl. 88): „Vielleicht herrscht im Protestantismus zu viel Ethos und zu wenig Sprachlosigkeit, also zu wenig Kultus und zu wenig Mystik“ (87).
An Glauben fehle es dem Menschen im Anthropozän dabei gar nicht. Der Glaube an das Evangelium sei zwar durch Entmythologisierungsprogramme nahezu oxidiert. Ungebrochen hält sich jedoch der Glaube an den Menschen. „Während der Gottesglaube permanenter Entmythologisierung und Kritik ausgesetzt ist“, machen nämlich „Entmythologisierung und Kritik vor dem Glauben an den Menschen halt“ (51). „Rätselhafterweise ist die Frage, wie man angesichts der Untaten des Menschen noch immer an den Menschen glauben kann, trotz allen Terrors und trotz aller Scheusslichkeiten des Homo sapiens kaum zu hören“ (145). Der moderne Mensch glaube „an alles Übermenschliche, nur nicht an die Gnade“ (193).
Der Glaube wurde, so könnte man sagen, „enttranszendiert“ – quasi in die Immanenz hinein ausgekippt. Freilich kann dieser Glaube an den Menschen den Menschen weder retten noch ausfüllen. Im Einklang mit Dietrich Bonhoeffer geht Frisch davon aus, dass unsere zivile Gesellschaft die Bürde der Weltenrettung langfristig nicht tragen kann. Wenn die Welt letzte Wirklichkeit werde, wenn also die andersweltliche Wirklichkeit Gottes aus dem Blick gerate, komme es zum Hauen und Stechen. Die letzte Konsequenz eines vergotteten Diesseits sei der Nihilismus (vgl. 187).
Gott: Ein wenig Theologie für das Anthropozän ist eine fesselnde Lektüre. Immer wieder dachte ich: Endlich traut sich mal jemand, auszusprechen, was auf der Hand liegt und inzwischen doch als unsagbar gilt. Eine Kirche, die sich für Gott und das Kreuz schämt, ist auf dem besten Wege, sich abzuschaffen. Christen müssen daran festhalten, dass Gott ein freies Subjekt ist, das sich offenbart hat und noch heute zu seiner Schöpfung und zu seinem Volk spricht.
Kann ich also das Buch herzlich empfehlen? Wenn doch das Wörtchen „vielleicht“ nicht wäre! Es durchzieht als Signalwort das gesamte Werk (vgl. 181). Ähnlich wie sein geistiger Mentor Karl Barth bleibt Ralf Frisch in manchen Dingen und besonders in Fragen, die die Historizität der Offenbarung und des Evangeliums betreffen, vage. Barth beugte sich der Annahme, dass die Heilsgeschichte mit der Historie nur wenige Berührungspunkte habe. „Jesus als der Christus“ könne „innerhalb der historischen Anschaulichkeit nur als Problem, nur als Mythus verstanden werden“ (Karl Barth: Der Römerbrief, Zürich: TVZ, 1984 [1922], 6). Die Ostererzählung vom leeren Grab sei Legende, eben die zu bejahende Legende (vgl. Karl Barth: KD III.2, 1948, 543f [§ 47]. „Der alte Karl Barth sprach im Jahr 1964 mit Tübinger Studierenden über das Weihnachtslied ‚Vom Himmel hoch, da komm ich her‘. In dessen erster Strophe heißt es: ‚Ich bring euch gute, neue Mär.‘ ‚Herrlich‘, so Barth, „dass der Luther da von ‚Mär‘ geredet hat; er hat nicht gesagt: Historie!“ (Frisch, 175f). Luther konnte „Mär“ tatsächlich verwenden, um Lügen, Erfindungen und Ammenmärchen auszuzeichnen. Das Evangelium war über für ihn im Gegensatz zu bösen Mären allerdings eine gute Mär, daher eine „gute Nachricht“).
Diese Ambivalenz finden wir auch bei Frisch: Das Evangelium verzaubere die durch die aufklärerische Vernunft entzauberte Welt. „Der Mythos des Evangeliums bringt dieses Geheimnis des Glaubens zur Sprache, indem er vom rettenden Gott erzählt, der den Menschen die Angst nimmt und sie in die Freiheit führt“ (228). Das kann man so sehen, wenn man damit sagen möchte: Nicht das, was die Communis opinio gerade für historisch und/oder wahr hält, entscheidet über die Wirklichkeit des Evangeliums. Und das Buch enthält eindringliche Mahnrufe, die genau so verstanden werden können. Dort heißt es beispielsweise: „Alle Erlösungs- und Heldengeschichten, auch die ausdrücklich theologischen, sind also letztlich für die Katz, wenn die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi nicht real ist, wenn also nur das möglich, wirklich und wahr ist, was Bewohnerinnen und Bewohner einer aufgeklärten Welt für möglich, wirklich und wahr halten“ (179). Ich befürchte freilich, dass Frisch mehr als das sagen möchte. Wenn er bekennt: „Man könnte auch im Sinne Søren Kierkegaards sagen, dass es eines Sprungs bedarf, um zu glauben, dass also der Glaube nur Wiedergeburt oder Wunder sein kann“ (120), dann stellt er sich – so jedenfalls meine Einschätzung – in die Tradition des Fideismus. An gleicher Stelle, an der unser Autor eindringlich die Wirklichkeit der Auferstehung anmahnt, lesen wir: „Der Glaube hofft darauf, dass die christliche Erzählung zu schön ist, um nicht wahr zu sein. Er hofft darauf, dass Gott eines Jüngsten Tages die Fakten vorweisen wird, die weder die Theologie noch alle anderen Wissenschaften vorweisen können. Der Glaube klammert sich verlegen und verwegen an den Strohhalm der Hoffnung, dass Gott bewahrheiten wird, was wir nicht bewahrheiten können“ (179).
Die christliche Hoffnung war freilich für die Apostel keine bloß kontingente, sondern eine gewisse und lebendige Hoffnung. Der Begriff Mythos (griech. μῦθος) wird im Neuen Testament durchgängig negativ gebraucht und dem Evangelium als Wahrheit entgegengestellt (vgl. 1Tim 1,4; 2Tim 4,4; Horst Balz, „μῦθος“, in EWNT, 2011, Sp. 1094). Die Apostel sind nicht „ausgeklügelten Fabeln“ (griech. σεσοφισμένοις μύθοις) gefolgt, sondern „haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen“ (2Petr 1,16, vgl. 1Joh 1,1–4). Der christliche Glaube ist kein blindes Springen ins Ungewisse, sondern basiert auf historischen Tatsachen und Ereignissen, die von Augenzeugen zuverlässig überliefert worden sind. Wir hoffen nicht nur darauf, dass das Evangelium wahr ist, sondern wir vertrauen der Botschaft vom Kreuz, weil sie wahr ist.
Trotz dieser Kritikpunkte empfehle ich das Buch gerne weiter. Die Lektüre hat mir großes Vergnügen bereitet.
Ron Kubsch ist Studienleiter am Martin Bucer Seminar in München