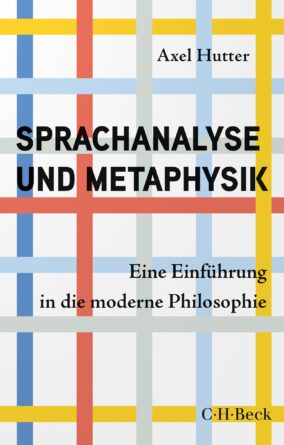Axel Hutter: Sprachanalyse und Metaphysik
Axel Hutter: Sprachanalyse und Metaphysik. Eine Einführung in die moderne Philosophie, München: C. H. Beck, 2025, Pb., 267 S., € 26,–, ISBN 978-3-406-82346-6
Axel Hutter, Professor für Theoretische Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, bietet eine gut lesbare Einführung in Gedankengänge einer an Wittgenstein orientierten Philosophie. Dabei widmet sich der erste Teil des Buches in fünf Kapiteln der Sprachanalyse, der zweite Teil in ebenfalls fünf Kapiteln der Metaphysik. Die Einführung beginnt in Kapitel 1 und 2 (11-64) mit einer Darstellung der Sprachanalyse Gottlob Freges und deren Weiterführung durch Bertrand Russell. Diese Kapitel dienen der Vorbereitung für die Beschäftigung mit dem Denken Ludwig Wittgensteins, der für Hutter offenbar die zentrale Gestalt der modernen Philosophie ist. In Kapitel 3 (65-89) werden dessen „Logische Untersuchungen“ (LU) aus dem Jahr 1921 erläutert. Wittgenstein vertritt hier eine Sichtweise, nach der Sätze Sachverhalte ausdrücken, und das heißt für ihn, dass nur Sätze der Naturwissenschaft wahre Sätze sein können. „Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die Gesamtheit der Naturwissenschaft“ (LU 4.11). „Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben“ (LU 6.42). Diese, vorsichtig gesagt, sehr einseitige Sichtweise wird später von Wittgenstein revidiert, Hutter sieht aber im Gegensatz zu manchen anderen Interpreten eine starke Kontinuität in seinem Denken. So sei Philosophie für ihn immer am Unbestreitbaren ausgerichtet. In Kapitel 4 (91-120) wird unter der Überschrift „Sprachspiele“ das Sprachverständnis des späten Wittgenstein beschrieben. Sprache wird jetzt vor allem als eine Tätigkeit verstanden, sie ist eine Praxis, die bestimmten Regeln folgt. Diese Regeln seien öffentlich, wie im folgenden Kapitel (121-144) dargelegt wird. Das richtige Verständnis dieser Sprachgebrauchsregeln mache deutlich, dass unser Sprachhandeln innerhalb eines Weltbildes erfolgt, das der Hintergrund ist, auf welchem wir zwischen wahr und falsch unterscheiden.
Im zweiten, metaphysischen Teil des Buches knüpft Hutter zunächst in Kapitel 6 unter dem Titel „Welt und Zeit“ (147-170) wieder an die Logischen Untersuchungen an, nach denen die richtige Methode der Philosophie sei, nur Sätze der Naturwissenschaft zu sagen und „dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat“ (LU 6.53). Da die metaphysische Welt als Gesamtheit der Tatsachen selbst keine Tatsache sei, könne man von ihr auch nicht reden. Ähnliches gilt vom metaphysischen Ich (Kapitel 7 Das Ich: Selbsterkenntnis, 171-192), dem Gebrauch des Ich als Subjekt: Das metaphysische Ich ist für Wittgenstein „die Grenze – nicht ein Teil – der Welt“ (LU 5.641). Diese Gedanken wurden von Elizabeth Anscombe aufgegriffen, nach der „Ich“ sich auf gar keinen Gegenstand bezieht (189). Kapitel 8 „Personen“ (193-216) führt diese Überlegungen weiter mit Hilfe des Buches Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics von Peter Strawson (London: Methuen, 1959). Eine Person sei kein Etwas, sondern ein Jemand, sei also nicht ausschließlich ein Vorkommnis in der Welt (also ein Sachverhalt), sie sei aber auch nicht ausschließlich die Grenze des Innerweltlichen wie das „Ich“. Beim Thema „Freiheit“ (217-236) unterscheidet Hutter zunächst Handlungsfreiheit (ich kann tun, was ich will) von Willensfreiheit (ich kann wollen, was ich will). Es sei die Willensfreiheit, nicht die Handlungsfreiheit, die der Person Würde verleihe (221). Diese Überlegung wird anhand eines Aufsatzes von Harry Frankfurt entfaltet. Frankfurt spricht von Wünschen zweiter Stufe: Ich kann wünschen, einen bestimmten Wunsch nicht zu haben. Im letzten Kapitel wendet sich Hutter der Frage zu „Was ist Philosophie?“ (237-254). Unter Bezugnahme auf Harry Frankfurt (On Bullshit, Princeton: UP, 2005) und Thomas Nagel kommt er zu dem Ergebnis, dass die Frage nach dem Sinn des Ganzen die Frage der Philosophie als Metaphysik sei (252). Die Philosophie thematisiere daher dasjenige, was nicht langweilig werden kann (254).
Das Buch ist ausgesprochen gut geschrieben, Hutter bemüht sich erfolgreich um Klarheit und Verständlichkeit – eine Tugend, die bei philosophischen Autoren bekanntlich nicht immer anzutreffen ist. Die Überlegungen bauen aufeinander auf, der rote Faden der Gedankenentwicklung ist erkennbar. Man erhält dadurch einen guten Einblick in die Entwicklung eines einflussreichen Stranges innerhalb der sogenannten Analytischen Philosophie. Für Irritationen sorgt allerdings der Untertitel des Buches: „Eine Einführung in die moderne Philosophie“. Er suggeriert, dass es so etwas wie die moderne Philosophie gebe und dass Hutter eine Einführung dazu biete. Manche Formulierungen des Buches verleiten zu einem derartigen Missverständnis, aber ich vermute, der Autor würde wohl nicht bestreiten, dass es ganz anders geartete philosophische Ansätze gibt (wie z. B. die Phänomenologie), die durchaus der modernen Philosophie zuzurechnen sind. Er würde vermutlich auch einräumen, dass es selbst innerhalb der Analytischen Philosophie viele Denker gibt, die manchen Überlegungen Wittgensteins sehr skeptisch gegenüberstehen und die in Bezug auf Sprachphilosophie und Metaphysik zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. Es scheint daher besser, den Titel in dem Sinne zu verstehen, dass hier eine Einführung in die moderne Philosophie vorgelegt wird, die eine bestimmte Denkrichtung gut verständlich näherbringt und dadurch einen ersten Eindruck von Themen und Überlegungen gibt, die in der modernen Philosophie verhandelt werden. Diesem ersten Schritt sollten dann weitere folgen, um mehr von der Breite der modernen Philosophie kennenzulernen. Dabei wird man dann auch auf gute Argumente stoßen, warum man Wittgenstein in manchem keineswegs folgen muss.
Wer mit dieser etwas bescheideneren Erwartung an das Buch herangeht, dass hier eine mögliche Einführung in die moderne Philosophie geboten wird, indem gut verständlich ein vor allem an Wittgenstein orientiertes Denken entfaltet wird, dem kann das Werk ausdrücklich empfohlen werden.
Dr. Ralf-Thomas Klein, Lehrbeauftragter für Philosophiegeschichte, Wissenschaftstheorie und Lateinische Quellentexte an der FTH Gießen