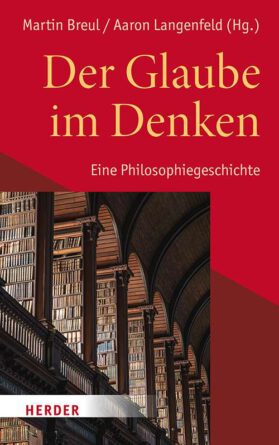Martin Breul / Aaron Langenfeld (Hg.): Der Glaube im Denken
Martin Breul / Aaron Langenfeld (Hg.): Der Glaube im Denken. Eine Philosophiegeschichte, Freiburg: Herder, 2023, geb., 448 S., € 28,–, ISBN 978-3-451-39384-6
Insgesamt sieben Punkte möchte ich zu dem Buch und seinem Umfeld markieren und festhalten.
1. Das Thema Glaube ist unerschöpflich. Es begann im Alten Testament (vgl. Otto Kaiser, „Glaube II. Altes Testament“, in: RGG⁴, Bd. 3, Sp. 944-947), und als der Glaube – noch genauer: Jesus Christus – in die Welt kam (Gal 3,23), da steigerte sich das Reden vom Glauben „explosionsartig“ (vgl. Eberhard Jüngel, „Glaube IV. Systematisch-theologisch“, in: RGG4, Bd. 3, Sp. 953-974, hier Sp. 953). Und bis heute setzt sich das Reden von Gott und vom Glauben in sehr vielfältiger Art und Weise fort, auch wenn es phasenweise (sehr) still war bzw. ist und es von Anfang an vom Zweifel und vom Atheismus begleitet ist. Atheistische Denkweisen werden bei Breul / Langenfeld von ihrem Ansatz her natürlich nicht präsentiert und nur vereinzelt und nur beiläufig theologisch anfangsweise reflektiert!
2. Dass der Glaube in seinen vielerlei Gestalten (Stichworte sind Religionswissenschaft und Religionsgeschichte), also auch der christliche Glaube eine Geschichte hat, ist im ersten Abschnitt unmittelbar ersichtlich. Bei Wilfried Härle (Dogmatik, Berlin: De Gruyter, 32007, 73) liest man die folgenden erhellenden Sätze: „Christlicher Glaube hat in allen seinen Erscheinungsformen selbst teil an der Geschichte und damit auch an der Veränderlichkeit und Wandelbarkeit […] Er ist eine geschichtlich bedingte Größe, die den jeweiligen kulturellen, gesellschaftlichen, politischen [und philosophischen] Bedingungen nicht entnommen ist, sondern an ihnen teilhat.“ Breul / Langenfeld sind dafür ein glänzendes Beispiel.
3. Joachim Matthes (1930-2009) wies in seiner Einführung in die Religionssoziologie 2. Kirche und Gesellschaft, Reinbek: Rowohlt, 1969, 152 auf den amerikanischen (Religions-)Soziologen Charles Y. Glock und dessen Beschreibung von Religion hin. Leider wurden beide im deutschsprachigen Denk- und Sprachraum nicht in der Breite aufgenommen. In Christian Danz u. a. (Hg.): Transformation of Religion. Interdisciplinary Perspectives, Paderborn: Brill Schöningh, 2023 revitalisiert und aktualisiert Hans Gerald Hödl die fünf Dimensionen von Religion nach Glock. Demnach geht es zwar auch ums religiöse Wissen, um Katechismen, Bekenntnisse und Dogmen, genauso jedoch auch um die rituelle Praxis, um religiöse Empfindungen und das individuelle Erleben, sowie das individuelle und gemeinschaftliche Tun. Breul und Langenfeld konzentrieren sich mit dem Stichwort ‚Denken‘ auf die erste Dimension des Glaubens. Das große Thema ist das Mit-, Neben- und Gegeneinander von Philosophie und Theologie.
4. Die (katholische) Grundüberzeugung Breuls und Langenfelds ist, „dass der Glaube nicht im Widerspruch zur Vernunft stehen kann“ (11). Erklärte doch Papst Benedikt XVI. in einer Generalaudienz 2012: „Die katholische Tradition hat von Anfang an den sogenannten ‚Fideismus‘ abgelehnt, der der Wunsch ist, gegen die Vernunft zu glauben. Credo quia absurdum (ich glaube, weil es absurd ist) ist keine Formel, die den katholischen Glauben interpretiert.“
5. Neben den vielen Männern gelangen nur drei Frauen zur Darstellung (Edith Stein, Hannah Arendt und ganz zum Schluss Judith Butler). Wichtiger ist erstens: Die Herausgeber sind personal orientiert; man vermisst strukturierende und ganze Epochen charakterisierende, zusammenfassende Beschreibungen. Eher beiläufig geschieht dies nur in einzelnen Beiträgen. Und wichtig ist zweitens: Außereuropäische und sehr frühe philosophische Denkansätze bleiben leider bei Breul / Langenfeld außen vor.
6. Die beiden Herausgeber gaben sich und ihren 47 Mitautoren die folgenden drei sehr guten, weil produktiven Leitfragen mit:
„(1) Welche Relevanz hat das dargestellte philosophische Denken für die Theologie?
(2) Was sind die wichtigsten und originellen Erkenntnisse des Philosophen / der Philosophin oder der Strömung?
(3) Welche Literatur empfiehlt sich zur vertieften Auseinandersetzung mit dem philosophischen Denkansatz?“ (12).
7. Der erste Philosoph, der von Thomas Schärtl dargestellt wird, ist Platon, neben Sokrates und Aristoteles einer der großen Athener Philosophen in der Antike. Bis auf die Bemerkung, dass „unter dem Stichwort ‚platonischer Theismus‘ in der gegenwärtigen Religionsphilosophie eine Position verhandelt, die – analog zum Timaios – Gott abstrakten Entitäten (Ideen, Universalien, Propositionen) untergeordnet oder gegenüber gestellt denkt“ (25), erfolgt kein weiterer Gegenwartsbezug. Leider. Denn da würde man gerne mehr erfahren.
Pfarrer i. R. Dr. Gerhard Maier, Neuffen