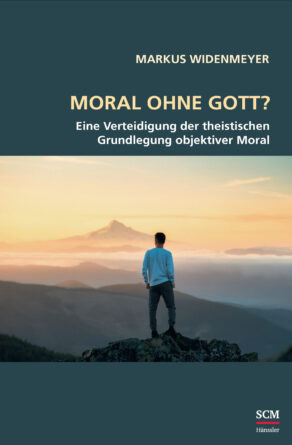Markus Widenmeyer: Moral ohne Gott?
Markus Widenmeyer: Moral ohne Gott? Eine Verteidigung der theistischen Grundlegung objektiver Moral, Studium Integrale Philosophie, Holzgerlingen: SCM Hänssler, 2022, geb., 167 S., € 15,40, ISBN 978-3-7751-6169-5
Markus Widenmeyer promovierte in Chemie und schloss später ein Philosophiestudium ab. Er ist einer der Leiter der Fachgruppe Philosophie in der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Er ist auch Autor von Welt ohne Gott? (2014) und Das geplante Universum? (2019) sowie gemeinsam mit Reinhard Junker Herausgeber von Schöpfung ohne Schöpfer? (2021).
Moral ohne Gott? argumentiert dafür, „dass es objektive Moral nur geben kann, wenn es Gott gibt“ (8). Gemeint ist der christliche Gott. Der Naturalismus wird im ganzen Buch die am stärksten beleuchtete Gegenposition dazu sein.
Kapitel 1. Einleitung (7–14) führt gut lesbar und anschaulich in ethische Fragen und ihre Relevanz ein. Kapitel 2. Gibt es objektive Moral? (15–24) bejaht diese Frage und führt als Belege an: unsere moralische Empfindung, die Sinnstiftung durch objektiv gute Lebensziele, die Rätselhaftigkeit der als objektiv empfundenen Moral und ihres geistigen Wesens. Der Autor ist sich bewusst: „Diese drei Punkte liefern keine strenge Widerlegung des moralischen Nihilismus“ (20). Dennoch sieht er die Objektivität der Moral als begründeter als ihre Alternative. Erst nach diesem Abschnitt erklärt er, wie er die Begriffe Moral und Ethik versteht. Seine Einführung in die Ethik setzt er in Kapitel 3. Normen, Werte, Handlungen und die Rolle von Personen (25–29) fort. Kapitel 4. Metaethische Kandidaten für objektive Moral (31–62) stellt verschiedene Theorien darüber vor, was moralischen Überzeugungen ihren Geltungsanspruch verleiht. In diesem Kapitel werden die bekannten Einwände besprochen: Gott könne nicht die Grundlage der Moral sein, denn die biblische Moral sei abzulehnen. Moral habe sich evolutionär entwickelt. Sie drücke lediglich Gefühle aus oder sei überhaupt eine Illusion. Die Gesellschaft oder die Sprachgemeinschaft lege fest, was richtig oder falsch ist. Hier und im Folgenden diskutiert der Autor verschiedene Positionen, die er verwirft, bis die Grundlegung der Moral durch Gott als einzige Alternative übrigbleibt.
Kapitel 5. Vom apersonalen zum personalen moralischen Realismus (63–135) ist länger als alle bisherigen Kapitel zusammengenommen. Widenmeyer setzt sich darin vor allem mit dem metaethischen Ansatz von Erik Wielenberg auseinander. Wielenberg sieht Moral als zusätzliches fundamentales Merkmal der Realität. Moralische Entitäten seien abstrakte Entitäten, die in einem „platonischen Reich“ existierten. Widenmeyer diskutiert konzeptionelle, epistemologische und ontologische Probleme dieser Sicht. Der letzte Teil des Kapitels besteht aus Erwiderungen auf Einwände Wielenbergs gegen den personalen moralischen Realismus. Hier bespricht Widenmeyer zum ersten Mal verschiedene Aspekte des Euthyphron-Dilemmas.
Kapitel 6. Der theistische moralische Realismus (137–155) stellt die aus Widenmeyers Sicht letzte verbleibende Alternative vor: Gott ist der Grund der Moral. Nur Gott hat absolute moralische Autorität. Er ist intrinsisch und maximal gut sowie der Schöpfer von allem. Daher stellt Gott die denkmöglich größte Autorität dar. So erklärt sich der absolute Geltungsanspruch moralischer Pflichten. Hier sieht sich Widenmeyer in der Tradition Anselms. Dinge können moralische Eigenschaften haben, weil sie ihnen von Gott zugemessen wurden. Wir Menschen können diese moralischen Eigenschaften erkennen, weil Gott uns mit einem „Bewertungsschema“ (143) dafür ausgerüstet hat. Widenmeyer zitiert Römer 2,14f und bemerkt: „Mir scheint das die beste, wenn nicht die einzige Erklärung dafür zu sein, dass wir objektiv bestehende moralische Wahrheiten wirklich erkennen können“ (145). Im Folgenden (148–153) geht Widenmeyer auf das Euthyphron-Dilemma in einer modernen Version ein: Sind Gottes Eigenschaften gut, weil Gott sie als gut festlegt, oder weil er sie an einem ihm externen Kriterium misst und als gut erkennt? Der Autor greift hier auf seine frühere Formulierung zurück: „Gut“ ist etwas, wenn es „von Gott als gut gedacht“ wird (148). Das gilt auch für Gott selbst: „Gott existiert also vernünftigerweise, wenn er sich als existieren sollend und damit als gut denkt und dadurch sich selbst bejaht“ (151f). Widenmeyer zitiert hier (152) Wittgenstein: „Der Spaten des Philosophen biegt sich hier zurück“ (PU §217). Auch in materialistischen Ansätzen werden Grenzen erreicht, aber Gott als Grundlegung der Moral ist diesen Ansätzen überlegen: „Im Rahmen eines theistischen Ansatzes kann Wittgensteins Spaten also in wesentlichen Hinsichten tiefer graben, bevor er sich zurückbiegt, und er findet einen einheitlichen, kohärenteren und schlankeren Satz an Prinzipien sowie den weitesten Erklärungsumfang“ (153). Dass Gott als notwendige, vollkommen gute Person die Moral begründet, erklärt die beziehungsfördernden und personalen Aspekte des Moralischen. In diesem Zusammenhang verweist er auch kurz auf die christliche Vorstellung der Trinität.
Kapitel 7. Zusammenfassung (157–163) bietet zunächst den Gedankengang des Buches in verdichteter Form. Daran schließen kurze Beobachtungen zum moralischen Argument für die Existenz Gottes und der damit zusammenhängenden Geltung des doppelten Liebesgebotes (Mt 22,37–39). Das Buch endet mit einem Literaturverzeichnis (164f) und einem kurzen Glossar (166f).
Moral ohne Gott? behandelt ein sehr wichtiges Thema auf hohem Niveau. Gleichzeitig bietet es eine Einführung in philosophische Ethik. Stellenweise ist es sehr anspruchsvoll geschrieben. Ich habe viel daraus gelernt, nicht nur an den Stellen, die mich überzeugt haben, sondern auch an denen, wo es mir zu schnell gegangen ist oder ich noch Fragen hätte. Für eine Neuauflage würde ich mir vier Änderungen wünschen:
Ein Personenregister würde sehr dabei helfen, das Buch immer wieder zur Hand zu nehmen um nachzulesen, wie der Autor auf bestimmte Philosophen eingeht.
An manchen Stellen war mir nicht klar, ob sich der Autor wiederholt oder weshalb er diesen Aufbau des Buches wählt: Werden naturalistische Metaethiken bereits auf Seite 33 oder erst auf den Seiten 51–58 diskutiert? Weshalb werden die verschiedenen metaethischen Positionen erst dargestellt, nachdem der Non-Kognitivismus und metaethischer Naturalismus besprochen wurden? Das Schaubild und die „Einteilung metaethischer Positionen“ (38) kommen auf Seite 39 zu spät.
In der Praxis werden uns weniger Platonisten begegnen, daher sollte Kapitel 5 kürzer sein. Stattdessen könnten verbreitete Theorien wie der „Schleier des Nichtwissens“ (Rawls), Bewusstsein (und damit Moral) als grundlegende Eigenschaft der Materie oder evolutionistische Vorstellungen (mehr) Raum erhalten.
Der christliche Gott ist eine liebevolle Gemeinschaft von drei Personen in einem Wesen und damit etwas anderes als ein deistischer, islamischer oder unitarischer Gott, der sich selbst vernünftigerweise als gut und existierend denkt. Diesen Unterschied herauszuarbeiten wäre noch das Sahnehäubchen für dieses anspruchsvolle und wertvolle Buch gewesen.
Dr. phil. Christian Bensel ist Referent bei „Begründet Glauben“ in Oberösterreich