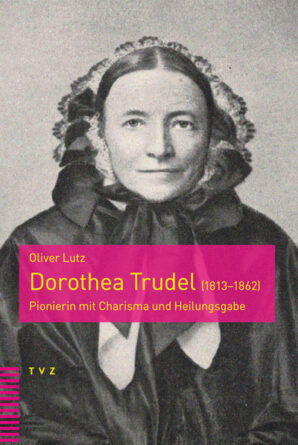Oliver Lutz: Dorothea Trudel (1813–1862)
Oliver Lutz: Dorothea Trudel (1813–1862). Pionierin mit Charisma und Heilungsgabe, Zürich: TVZ, 2024, Pb., 365 S., € 52,–, ISBN 978-3-290-18649-4
Weithin bekannt sind Johann Christoph (1805–1880) und Christoph Friedrich Blumhardt (1842–1919), die während ihres Dienstes in Möttlingen und Bad Boll zahlreiche Gebetsheilungen erlebten. Stephan Holthaus zählt in seinem Standardwerk über die Heiligungsbewegung Heil – Heilung – Heiligung (2005) neben den beiden Blumhardts auch das Heilungsheim in Männedorf unter der Leitung von Dorothea Trudel (1813–1862) und ihrem Nachfolger Samuel Zeller (1834–1912) zu den hauptsächlichen „Vorläufern und Wegbereitern“ der Heilungsbewegung (Teil X, A, 334–341). Er hebt die Wirksamkeit von „Jungfer Trudel“ hervor: „Der Einfluss Dorothea Trudels kann nicht überschätzt werden. Hunderte von Christen haben in Männedorf Heilung von Krankheiten erfahren …“ (Holthaus, a .a. O., 338).
Die christliche „Gebetsheilanstalt“ (andere Bezeichnungen: 33) von Dorothea Trudel in Männedorf am Zürichsee war zu ihrer Lebenszeit in pietistisch-freikirchlichen Kreisen über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt. Sie hat zudem den entscheidenden Anstoß für die Übung des Krankengebets gegeben, bevor es als exklusives Merkmal von Pfingstgemeinden verstanden wurde. Dies wird unisono in der Sekundärliteratur zur Heilungs- und Heiligungsbewegung festgestellt.
Umso erstaunlicher ist es, dass es bisher keine umfangreiche neuere Untersuchung zu Dorothea Trudel und Männedorf gab. Ebenso sind die vorhandenen handschriftlichen und gedruckten Quellen bis anhin noch nicht umfassend ausgewertet worden. Nur Thomas Schirrmacher (1988) und Jürgen Seidel (2004) haben in kleinerem Umfang in ihren wissenschaftlichen Aufsätzen auch Quellen berücksichtigt[1] .
Im ersten Teil (Einleitung, 19–37) seiner an der UNISA eingereichten Dissertation fasst Oliver Lutz den Ertrag bisheriger Veröffentlichungen zum Thema zusammen und formuliert seine Forschungsfrage: „Spiritualität Dorothea Trudels und Aspekte ihrer Rezeption im Pietismus und in der transaltlantischen Heilungsbewegung“ (20). Entsprechend befassen sich die beiden Hauptteile mit der Spiritualität der Schweizer Seelsorgerin (2. Teil, 39–189) und der Rezeption ihres Lebenswerks durch fünf Persönlichkeiten bzw. Institutionen (3. Teil, 191–296).
Auf sechs Seiten wird als Ertrag „Das Erbe von D. T. für heute“ zusammengefasst (4. Teil, 297–302), eine ausführlichere Zusammenfassung der gesamten Arbeit schließt sich an (5. Teil, 303–319).
Der Anhang präsentiert eine Tabelle von 118 Korrespondenten, die für den Medizinalprozess gegen D. T. handschriftlich ihre Heilung durch dieselbe bezeugten (6. Teil, 321–342, vgl. 29f). Den Schluss der Monographie bildet das Verzeichnis von Archivalien, Primär- und Sekundärliteratur (7. Teil, 343–365).
Zum ersten Mal hat Trudel vier kranken Arbeitern des Seidenband-Betriebs von Jakob Dändliker – in dem sie selbst zeitweise arbeitete – unter Gebet die Hände aufgelegt; dies führte „nach nur wenigen Minuten“ zur Heilung ihrer Schmerzen (59, Ereignis undatiert, nach 1851). Nach Kontakten mit Darbysten und Brüdergemeinen in der Schweiz übernimmt sie die Lospraxis der Herrnhut. Die Losungen sind für ihre Spiritualität von großer Bedeutung, nicht nur bei der täglichen Auslegung der ausgewählten Bibelverse, sondern auch vor wichtigen Entscheidungen wie der Erweiterung der Heilanstalt und zum Beispiel am Neujahrsmorgen (vgl. 76f, 81f, 98f, 111, 155f, 182, 208). Die Praxis des Losbefragens blieb allerdings nicht ohne Kritik; sie wurde durch Samuel Zeller korrigiert (vgl. 128, 201, 228).
Dorothea Trudels Einrichtung wuchs schnell. 1857 wurde ein zweites Haus gekauft, 1859 ein drittes mit einem Andachtssaal für 80 Personen. Erst nach dem Tod der Gründerin am 6.9.1862 wird 1863 das Haus Elim mit einem noch größeren Betsaal eingeweiht.
Wegen „Einmischung in das Heilgeschäft“ (67f) wurde Trudel schon 1857 mit einer Strafe von 60 SFr belegt; die Kranken mussten nach Hause geschickt werden. Die Zahl der Besucher und Heilungsuchenden wuchs dennoch weiter, unter ihnen bekannte Erweckte des Schweizer Réveil und Pietisten, besonders aus Württemberg, wie Charlotte Reihlen, Prälat Sixt Kapff, Félix und Hélène Bovet, Mathilde und F. A. G. Tholuck, Frédéric Godet, ein Baron von Barsewisch aus Baden-Baden, der Schweizer Philosoph Charles Secrétan, William Marriott, Elias Schrenk, Arnold Bovet, der bekannte Heiligungsprediger Robert Pearsall Smith und auch Otto Stockmayer (89–91, 115f, 129f, 217, 249–252). Es war Trudel wichtig, durch ihren Dienst Menschen in der Nachfolge bewusst zu fördern (135f).
Die zuständige Medizinaldirektion Meilen ruhte derweil nicht und hatte beständig ein kritisches Auge auf die Gebetsheilanstalt. So kam es 1861 zu einem Gerichtsprozess. Obwohl eine beeindruckende Liste von Heilungszeugnissen vorgelegt werden konnte, wurde Trudel zu einer Strafe von 154 SFr verurteilt (136–171).
Besondere Aufmerksamkeit verdient der dritte Teil von Lutz’ Untersuchung über die weitreichende Rezeption der Gebetsheilungspraxis. Maßgeblich für die Aufnahme der Männedorfer Impulse war Samuel Zellers ab 1862 in achtzehn Auflagen verbreitete Buch Aus dem Leben und Heimgang der Jungfrau Dorothea Trudel (201). Im Unterschied zu Robert Pearsall Smith vertrat Zeller die Meinung, dass Heiligung nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch Zucht erreicht werden könne (217f).
In der Canstatter „Villa Seckendorff“ der Henriette L. M. Freiin von Seckendorff-Gutend (1819–1878) fand Dorothea Trudels Männedorfer Werk eine ebenbürtige Nachahmerin (231–247). Viele adelige Kranke aus Estland suchten in ihrer Villa Heilung. Auch von Seckendorf lebte und predigte mit dem Losungsbuch. – Der führende Vertreter der Heiligungsbewegung im deutschsprachigen Raum, Otto Stockmayer in Hauptwil (247–260), erlebte zwar bei Trudel Heilung, sah ihre Arbeit aber auch distanziert. – Das „Asyl“ Rämismühle (261–269), ein seelsorgerliches Pflege- und Gebetsheilungshaus im Tösstal bei Winterthur entstand aus einer pietistischen Gemeinschaft, die Kontakte zu den „Zellerschen Anstalten“ in Männedorf hatte. Leitende Personen der Anfangszeit waren die Diakonisse Marie Leumann, die Arbeiterin Babette Isler (1839–1899), die Pflegerin Elise Gossweiler (1851–1921), und Georg Steinberger (1865–1903), der später als Chrischona-Prediger bekannt wurde. Als die Versammlungen des Evangelisationswerkes Männedorf der Evangelischen Gesellschaft (EG) Zürich angegliedert wurden, beschloss die Versammlung in Rämismühle 1887, zukünftig zum Verband der Pilgermission St. Chrischona zu gehören.
Besonders wichtig wurden die Lektüre der Trudel-Biographie von Zeller und ein Besuch in Männedorf im Jahr 1873 für Charles Cullis (1833–1892), der 1882 ein Faith Cure Home eröffnete (269–289). Seine Inspiration durch das Schweizerische Gebetsheilungswerk führte in der US-amerikanischen Divine Healing Movement dazu, dass Dorothea Trudel „innerhalb der amerikanischen Heilungsbewegung zu einer bekannten Grösse“ wurde. Im Gegensatz zu diesem in der amerikanischen Forschung gut aufgearbeiteten letzten Teil der exemplarischen Rezeptionsgeschichte warten die ersten vier deutsch-schweizerischen Abschnitte (S. Zeller, H. v. Seckendorff, O. Stockmayer und „Asyl“ Rämismühle) noch auf intensivere Erforschung.
Abschließend sieht der Verfasser Dorothea Trudels Erbe in der Gegenwart im wachstümlichen geistlichen „Leben in der Schule Gottes“, im Vertrauen auf Gottes Wort und im Gebet für die Kranken nach Jakobus 5 (300–302).
Oliver Lutz erschließt mit seiner Dissertation eine Fülle von Originaldokumenten und Sekundärliteratur, deren Existenz man bei einer vermeintlich „kleinen“ christlichen Institution nicht vermutet hätte. Es mag an den vorausgesetzten Guidelines der UNISA liegen, dass die Erfassung der Personennamen und -viten sowie der verwendeten Archivmaterialien und Literatur nicht dem Standard der Vereinheitlichung entspricht, die der Rezensent bei einer Hochschulschrift erwartet hätte. Trotz dieser formalen Desiderate überzeugt der Band durch die Vielfalt erstmals veröffentlichter Dokumente und entdeckter Beziehungsgeflechte, die bisher unbekannte Aspekte des Netzwerks der Frommen im 19. Jahrhundert besonders in der Schweiz und in Deutschland ans Licht gebracht haben.